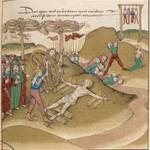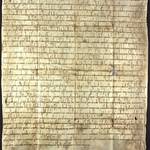Teutschenthaler Heimatgeschichten
Liebe Heimatfreunde,
die Einheitsgemeinde Teutschenthal liegt inmitten einer Jahrtausende alten Kulturlandschaft. Aufgrund seiner geographischen Lage war dieses Gebiet seit jeher eine wichtige Drehscheibe für den Austausch in Mitteleuropa. Die hohe geschichtliche Bedeutung zieht sich bis in unsere Gegenwart und hat sich in unseren Ortsbildern niedergeschlagen.
Als Archäologe und Kunsthistoriker mit dem Schwerpunkt auf den mitteldeutschen Raum befasse ich mich auch beruflich mit dieser Thematik. In meiner ehrenamtlichen Funktion als Ortschronist möchte ich Sie an meinen interessanten Erkenntnissen zur Heimatgeschichte teilhaben lassen. Mit den „Teutschenthaler Heimatgeschichten“ möchte ich Sie noch mehr für unsere Umgebung interessieren und vor allem begeistern. Die Texte erheben dabei keinen wissenschaftlichen Anspruch bzw. das Vorrecht auf Vollständigkeit. Für Ergänzungen und Anregungen stehe ich Ihnen gern unter mike-leske@web.de zur Verfügung.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Mike Leske M.A.